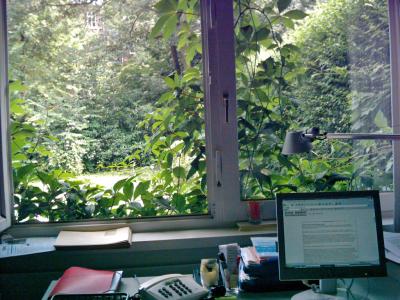Schön, daß wir mal wieder davon hören.
stern.de Wirtschaft zeigt heute mal wieder darauf:
"Satte Gewinne [vermeldet der Kommentar richtig] -
hoffentlich für alle [frommwünscht der Kommentator niedlich]".
"Die Lufthansa hat 2005 einen Gewinnsprung von 154 Prozent gemacht, Linde 113 Prozent, Bayer 151 Prozent - um nur einige Beispiele zu nennen." Ja. Das ist die Höhe. Aber es ist ganz und gar neu nur für diejenigen, die wirklich glauben, hohe Löhne hingen von hohen Profiten ab. Das tun sie mitnichten - im Gegenteil: hohe Profite gibt es bei niedrigen Löhnen.
"Von diesem Profit sollten alle profitieren." Oh ja, wer von denen, die nicht profitieren, träumt nicht vom Mitprofitieren? Schaun wir mal,
wie naiv die Vorstellungen sind:
"Das Profit-Einfahren diktiert der (Welt-)Markt. Knallhart, ohne Moral. Das Treiben betrachten wir mal staunend, mal murrend, oft kleinmütig. Das Ausreizen und Missachten der wenigen Marktregularien bringt zwei Zünfte in Lohn und Brot: Berater und Anwälte. Alle anderen in der freien Wirtschaft, zu vorderst wir Arbeitnehmer, leben vom Ausschütten der Profite. Deshalb reden wir seit gut 100 Jahren darüber mit. Ein bisschen zumindest. Politisch." Hm. Das klingt ja richtig nüchtern und realistisch. Aber es ist falsch. Im Ansatz falsch. Denn wir leben nicht alle in der freien Wirtschaft von der "Ausschüttung der Profite", schon gar nicht die "Arbeitnehmer" - also die Arbeitskraftgeber, um genau zu sein. Die leben nämlich von ihrem Lohn. Der Lohn ist das, was auf dem Arbeitsmarkt als Äquivalent für den Verkauf der Ware Arbeitskraft zu erzielen ist. Über die Höhe der Profite oder gar über deren "Ausschüttung" hatte der "Arbeitnehmer" noch nie mitzureden. Kein bißchen. Was aber seit 150 Jahren nicht vergeht, ist die Vorstellung vom "gerechten" Lohn - hier kommt sie sogar als naive Forderung nach
"angemessener Gewinnbeteiligung" (siehe unten).
Nun kann man natürlich weiterhin an die Kraft des Wünschens glauben - hartnäckig, obwohl es seit nunmehr 7 Generationen nichts geholfen hat.
Man kann aber statt in Märchen herumzuwünschen auch bei Marx nachschauen, wie die Ökonomie des nunmehr einen Systems funktioniert, man kann sich dabei auch helfen lassen, etwa von Georg Fülberths Artikeln in Konkret - wenn man bloß nicht so verdammt darauf fixiert wäre, sich die Funktionsweise dieser Ökonomie ausgerechnet von denen erklären zu lassen, die darin die Profite machen, oder - Kehrseite der Medaille - von den Kleinbürgern, die ihre (verständliche) Wut schon für Analyse halten und denen drum die Globalisierung und die Finanzmärkte als der böse Kapitalismus, das "einheimische" mit "einheimischen" ArbeitskraftzuMarktetragenden Menschen Profit erzielende Unternehmertum aber als guter, gerechter oder doch wenigstens erträglicher Kapitalismus gelten.
Höhere Löhne gibt es nicht, weil die Profite hoch sind und drum die Profiteure spendabel - höhere Löhne gibt es, wenn der Marktpreis der Ware Arbeitskraft gestiegen ist. Und das tut er, wenn diese Ware Mangelware wird. Davon kann aber weißgott keine Rede sein in einer Zeit, wo die freigesetzte Arbeitskraft schon froh sein muß, wenn sie sich für einen Euro die Stunde feilbieten oder zu ganz offiziellen Bedingungen leiharbeiten darf, und trotzdem nicht mehr hat als ein Sozialhilfeempfänger. (Natürlich kann man mit dem Finger auf die maximierten Profite zeigen und daran seine Lohnforderungen festmachen. Zwar hilft es nicht - aber immerhin.)
Aber der Kommentator meint vielleicht, die Gemeinschaft via Staat könne am Gewinn beteiligt werden.
"Weltweite Arbeitsteilung: Die Investitionsziele der Firmen liegen, wie viele ihrer Gewinnquellen, zunehmend außerhalb Deutschlands. Ein erheblicher Teil der Profite (und Arbeitsplätze) wandert schnurstracks an der heimischen Wirtschaft vorbei. Kein Mensch, am wenigsten ein Politiker, kann diese Wanderung aufhalten. Sie ist nicht neu, sondern begann schon in den 60er Jahren, also im Anschluss an das Binnen-"Wirtschaftswunder". Nur kurz - zu Beginn der 90er Jahre - verringerte sich der deutsche Drang hinaus in die Welt. Die Ex-DDR lag näher. Doch schon bald lockten wieder die Möglichkeiten der globalisierten Märkte, die weltweite Arbeitsteilung. " Richtig! Und wieder so nüchtern realistisch. Aber der Kommentator hofft entgegen aller Einsichten auf ein Einsehen, (obwohl doch kein Mensch, am wenigsten ein Politiker...) denn:
"Exportweltweister - Made in Germany". Kein Problem, solange zu Hause alles im Lot schien. Jetzt, da Arbeitsmarkt, Rente, Gesundheit, Pflege und Staatsfinanzen, endlich auch anerkanntermaßen marodieren, ist es ein Problem." Und da vergißt er in der Eile zu fragen, für wen...
Und höre ich richtig: Das patriotisch gesinnte Kapital kommt "nach Hause", weil der Haussegen schief hängt und die "Heimat" in Ordnung gebracht werden muß - und spendet dafür auch noch einen Teil des Profits? - Nebbich!
Zwar werden
"fromme Appelle (..) es ebenso wenig lösen, wie gestriges Geschrei. Es braucht politische Vorgaben. Durchdacht, verlässlich und handwerklich einwandfrei. Realistischerweise sollten sich auf diese Art zumindest zwei Sanierungsbeiträge von unseren "Global-Playern" einfordern lassen: Zum einen, dass sie in der Heimat angemessene Steuern zahlen, und dass Spartenverkauf und Abwanderei nicht länger subventioniert werden."
Ach ja, da wollen wir wieder träumen - diesmal vom Primat der Politik, der mit "handwerklich einwandfreiem" politischen Handeln einzufordern wäre und den es doch auch nie gegeben hat. Handwerklich einwandfreies politisches Handeln kann es in diesem ökonomischen System gar nicht geben - nur mehr oder weniger ungeschicktes Handwerkeln. (Und welches Ausmaß an Marodität staatlicher und gesellschaftlicher Strukturen für den Maximalprofit hinzunehmen, das Kapital in der Lage ist - das kann man überall auf der Welt betrachten. Von diesen möglichen hinzunehmenden maroden Zuständen sind wir hier allerdings weit entfernt.)
Und wenn der Kommentator es so trotz aller Zwars und Abers in aufblitzendem Realismus wieder in die Märchenwelt zurück geschafft hat, dann auch gleich richtig - siehe oben:
"Zum anderen, dass heimische Mitarbeiter angemessen an den Gewinnen beteiligt werden - was nicht bedeuten muss, Lohnstückkosten wettbewerbsschädlich zu erhöhen." Und er träumt von
"neue(n) Formen der Mitarbeiter-Beteiligungen".
Es gibt nur einen Grund, warum Unternehmen über
Mitarbeiter-Beteiligung nachdenken: Damit die "Mit"arbeiter besser "mit"arbeiten. Vulgo höheren Profit erzeugen. Das kann unter Umständen tatsächlich im Interesse der Beschäftigten liegen. Aber es handelt sich auch dabei um nichts weniger als um "Profit-Ausschüttung".
Trotzdem schön, daß wir mal wieder drüber reden konnten.