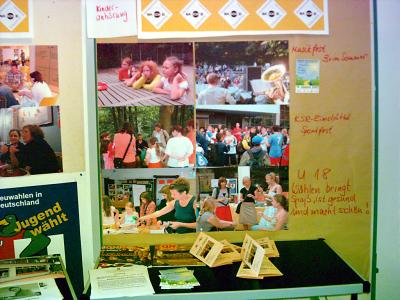„Demokratieerziehung in Hamburg“ vom 25.-29.10.05 am
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg
In seinem öffentlichen Gespräch mit
Reinhard Kahl am Abend des 25. Oktober machte
Prof. Wolfgang Edelstein zum Auftakt der Tagung deutlich, daß Demokratie nicht bloß eine Sache der Institutionen und Gremien ist, sondern eine Lebensform, die nur gelernt werden könne, indem sie stattfindet.
Seine Aufforderung, Verbündete zu suchen für die Entwicklung der Hamburger Schule zu einer demokratischen Schule für Alle, stellte sich als Hintergrund-Motto der gesamten Tagung heraus.
Tatsächlich boten die intensiven Arbeitstage im Landesinstitut mit drei Referaten und daran anschließenden Diskussionsforen, einem Vortrag, mit über 30 Workshops und ebensovielen Infoständen sowie einer abschließenden Talkrunde zum ersten Mal überhaupt die ausgezeichnete Gelegenheit, Kommunikations- und Kooperationspartner – Verbündete also – in allen Gruppen innerhalb der Institution Schule sowie in der außerschulischen Jugendpädagogik an einem zentralen Ort kennen zu lernen, dabei Kontakte zu knüpfen, sich über die Grenzen des eigenen Praxisraums hinweg auszutauschen und Verabredungen für eine Zusammenarbeit zu treffen. Diese Chance war der Hauptgewinn der Tagung, und sie wurde reichlich genutzt. Ein weiterer wichtiger Erfolg der Tagung ergab sich aus der Bereitstellung einer offenen Atmosphäre, in der öffentlich kontrovers diskutiert und produktiv gestritten werden konnte. Dabei wurden die Kernprobleme und –fragen deutlich, die gelöst werden müssen auf dem Weg zu einer demokratischen Lernkultur und einer Schule für Alle.
 Schüler einer 10. Realschulklasse präsentieren das „Textil-Projekt“, eines der Projekte "Sozial macht Schule", initiiert und begleitet durch Rainer Micha vom Arbeiter Samariter Bund.
Schüler einer 10. Realschulklasse präsentieren das „Textil-Projekt“, eines der Projekte "Sozial macht Schule", initiiert und begleitet durch Rainer Micha vom Arbeiter Samariter Bund.
Die Workshops und Infostände spiegelten die Vielfalt dessen wider, was in Hamburg an Projekten in Schulen, Stadtteilinitiativen und Verbänden mit Kindern und Jugendlichen im Bereich demokratischen Engagements existiert. Dabei haben sich auch beeindruckende Kooperationsprojekte entwickelt, wie beispielsweise das Projekt „Dialog der Urenkelinnen und Urenkel“, ein Projekt der Initiative „Sozial macht Schule“ des Arbeiter Samariter Bunds. Eine Klasse der Schule „Charlottenburger Straße“ hatte in Hamburger Archiven über tschechische Zwangsarbeiter geforscht, mit den Überlebenden in Tschechien Kontakt aufgenommen und einen Dialog begonnen, der auch zu gegenseitigen Besuchen geführt hatte. Seit 2002 wird das Projekt außerdem von
Prof. G. Mitchell und Studierenden der Hamburger Universität wissenschaftlich begleitet und ist in einem Film dokumentiert worden. Dies ist nur eines der Beispiele, daß Schule, Jugendhilfe und Universität erfolgreich kooperieren können.
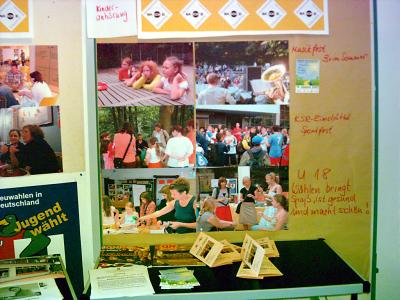 Infostand des Projekts „Kinderrechte und Stadtteilradio“ in der Initiative "Nachbarschaft und Schule Eimsbüttel (NaSchEi)“ mit Ragna Riensberg und Yvonne Vockerodt
Infostand des Projekts „Kinderrechte und Stadtteilradio“ in der Initiative "Nachbarschaft und Schule Eimsbüttel (NaSchEi)“ mit Ragna Riensberg und Yvonne Vockerodt
An manch anderen Projekten – die darum jedoch nicht weniger gelungen und beeindruckend sind – wird aber auch deutlich, wie mühsam und schwierig es ist, eingefahrene, sich sperrende Strukturen aufzubrechen, um Kooperation zu ermöglichen und die nötige Unterstützung zu gewinnen. Ragna Riensberg und Yvonne Vockeroth, die mit Workshop und Infostand ihr überaus erfolgreiches Projekt Kinderrechte – Stadtteilradio präsentierten, wünschen sich beispielweise eine bessere Zusammenarbeit mit der Lehreraus- und Fortbildung, damit die Initiative an mehr Schulen bekannt und genutzt werden könnte. Auch die nötige finanzielle Förderung ergibt sich nicht von selbst. Weiterentwickelt zu einem Service-Learning-Projekt könnten hier auch ältere Schüler mit den Kindern im Stadtteilradio arbeiten. Das „Radio von Kindern für Kinder“ ist ein Projekt von und für Vorschul- und Grundschulkinder. In bisher über 80 Sendungen haben Kinder über ihre Themen gesprochen und Hörszenen gespielt. Kinderrechte, Gewalt, Gesundheit, Spielmöglichkeiten, Zukunft, Ernstgenommenwerden von den Erwachsenen - das sind die Themen, die in der „Kinderanhörung“ zur Sprache kommen. (Freies Senderkombinat 93,0 khz, jeden 3. und 4. Donnerstag im Monat.) Beeindruckend ist, wie professionell die Kinder dabei nicht nur mit dem Medium Radio umgehen, sondern auch, wie souverän sie Politik machen, indem sie ihre Meinungen artikulieren, begründen und argumentieren. „Kinder sind Experten für ihre Bedürfnisse“, sagt Ragna Riensberg, und die überzeugenden Radiospots der Kinder geben ihr Recht. Diese Einsicht muß in der Schule erst noch ankommen!
 Im Workshop für Schulleitungsmitglieder von Claudia Wetterhahn und Dr. Gabriele Kandzora stellten sich 40 Teilnehmer dem Paradoxon "Schule demokratisch leiten". Es war der Workshop mit der höchsten Teilnehmerzahl. Trifft sich hier besonderer Problemdruck mit hoher Veränderungsbereitschaft?
Im Workshop für Schulleitungsmitglieder von Claudia Wetterhahn und Dr. Gabriele Kandzora stellten sich 40 Teilnehmer dem Paradoxon "Schule demokratisch leiten". Es war der Workshop mit der höchsten Teilnehmerzahl. Trifft sich hier besonderer Problemdruck mit hoher Veränderungsbereitschaft?
 Nachgespräche am Ende eines Forums
Nachgespräche am Ende eines Forums
 Demokratische Streitkultur
Demokratische Streitkultur
In ihrem spannenden Vortrag machte
Prof. Anne Sliwka die großen Chancen des Service-Learning nicht nur für den Erwerb sozialer Kompetenzen, sondern auch für Wissenserwerb überhaupt deutlich: Service-Learning setzt an echten Bedürfnissen der sozialen Umwelt – inner- oder außerhalb der Schule – an. Die Schüler arbeiten und lernen zugleich und sind durch die Identifikation mit ihrer – meist selbstgewählten – Aufgabe, hochmotiviert. Sie erleben, daß sie wirklich gebraucht werden. Unterricht ist hier keine simulierte Welt, in der nur für später trainiert wird, und die Schüler werden zu Experten dessen, was sie tun. Daß sie dabei auch noch lernen, im Team und eigenverantwortlich zu lernen, versteht sich dabei schon fast von selbst. Anne Sliwka erläuterte das Prinzip an einer Fülle von Beispielen. Eines sei hier stellvertretend genannt, weil es besonders deutlich macht, daß es sich bei Service-Learning nicht um caritative Projekte herkömmlicher Art handelt:
„Philadelphia Math Trail“ ist ein Service-Lerning-Projekt von Schülern einer 10. für Schüler der 9. Klasse. In einer Stadtrallye müssen anhand städtischer Objekte mathematische Aufgaben gelöst werden, wie z.B. die Berechnung der Höhe einer Riesenskulptur. Ob die Schüler dabei das Service-Learning-Projekt erst selbst (er)finden oder in schon bestehende Projekte nachwachsen, oder ob Service-Learning generell freiwillig sein müßte oder gerade als Unterrichtsprinzip in der Schule verpflichtend gemacht werden sollte – das scheint eine müßige Diskussion zu sein, denn – wie in der Diskussion zum Vortrag deutlich wurde - , wichtig ist, daß die Schüler eine Aufgabe finden, die sie als ihre eigene Aufgabe begreifen können, mit der sie einen persönlichen Sinn verbinden können. Diese Art des Lernens funktioniert deshalb mit hohen Ergebnissen, weil sich der persönliche Sinn des einzelnen Schülers mit der gesellschaftlichen Bedeutung einer Arbeit/Lernaufgabe deckt. In anderen Ländern – z.B. in Kanada – ist diese Form des Lernens darum seit vielen Jahren etabliert und die Ergebnisse sind wissenschaftlich evaluiert. Etliche Schulen arbeiten ausschließlich auf der Basis des Service-Learnings. Daß die Schüler dabei vieles, was sie für die erfolgreiche Durchführung ihrer Projekte brauchen, auch in Trainings, im Lesen von Papieren oder Internetseiten lernen oder sich auch mal einen Vortrag anhören müssen, kann man sich vorstellen. „Alte“ Lernmethoden haben dadurch also keineswegs ausgedient, denn: Form follows function!
Die Frage ist also längst nicht mehr die, ob Service-Learning als Unterrichts-Prinzip in Zukunft eine bedeutende Rolle spielen muß, um die Probleme der Hamburger Schule zu lösen und die Lernergebnisse aller Hamburger Schüler deutlich zu verbessern. Das Problem besteht vielmehr darin, wie man diese Form einer neuen Lernkultur in die Hamburger Schule implementieren kann. Die Schwierigkeit, all diese vorgestellten Projekte in der Schule zu etablieren, ist immer dieselbe: Sie rein additiv zum bestehenden Unterrichtsprogramm zu ergänzen, ist selbst dann, wenn es Sinn machen würde, schwierig. Besonders deutlich wurde dies im Diskussionsforum „Ehrenamtliche Tätigkeit – eine Bildungsressource“. Die Vertreter der Verbände klagten darüber, daß mit der flächendeckenden Einführung der Ganztagsschule einerseits Probleme auftauchen, die ehrenamtliche Tätigkeit außerhalb der Schule unterzubringen. Hier wünscht man sich eine bessere Kooperation zwischen den Institutionen.
Andererseits sind Jugendliche aber zu einem erstaunlich hohen Prozentsatz bereit, etwas Sinnvolles für ihre soziale Umgebung zu tun. Hier zeigt sich auch, daß sie durchaus nicht Demokratie- oder Politik-müde sind. Deutlich wurde auch, daß Jugendliche sich zunehmend lieber in kurz- oder mittelfristigen besonderen Projekten engagieren wollen anstatt ein Ehrenamt im traditionellen Sinne als Lebensaufgabe in der Freizeit anzunehmen. (Dies spricht ebenso sehr für die Form des Service-Learning.) Die Frage lautete also, wie können unter den bestehenden Strukturen der Institution Schule Handlungs-Spielräume genutzt und erweitert und die Strukturen so umgebaut werden, daß die Erfordernisse der Gesellschaft – z.B. soziale Bedürfnisse im Stadtteil – mit den Lernbedürfnissen und –erfordernissen der Schüler in Einklang gebracht werden? Darüber, wie diese Aufgabe mit dem Ziel der Demokratieerziehung in Einklang zu bringen sei, wurde zum Teil kontrovers und heftig debattiert.
In der abschließenden Talkrunde stellte sich dieses Problem dank der provozierenden Auftaktfrage des Moderators
Herbert Schalthoff besonders zugespitzt: „Wie können Sie sich im Landesinstitut eine Tagung zum Demokratielernen leisten, wo wir doch seit der Veröffentlichung der schlechten PISA-Ergebnisse weiß Gott ganz andere Bildungsprobleme haben?“, fragte Schalthoff und löste damit eine höchst lebendige und fruchtbare Diskussion unter den Teilnehmern im Podium sowie mit dem Auditorium aus.
In den vielfältigen Beiträgen von Lehrern, Fortbildnern, Eltern- und Schülervertretern, sowie der Vertreter von Stadtteil-Initiativen, wie z.B.
Rüdiger Winter vom
„Billenetz“ für lebenslanges Lernen, wurde klar, daß Schule vor der Aufgabe eines grundlegenden Wandlungsprozesses steht. „Schüler haben traditionell in Deutschland eine große Distanz zur Schule“, befand
Dr. Gabriele Kandzora, Didaktische Leiterin der Erich-Kästner-Gesamtschule. „Wenn es uns nicht gelingt, eine Schule zu schaffen, die die Schüler viel mehr beteiligt an allem, was mit ihnen in der Schule geschieht, dann wird es auch keine Verbesserung der Lernergebnisse geben“, urteilte sie und machte damit deutlich, daß ohne demokratische Partizipation innerhalb der Schule (Schul-„Innenpolitik“) Schüler weder zu demokratisch handelnden noch zu wissens- und leistungsstarken Persönlichkeiten heranwachsen können. Das eine sei ohne das andere nicht zu haben.
Kurt Edler vom Landesinstitut stellte dagegen fest, daß Schüler die bestehenden Strukturen zur Mitbestimmung gegenwärtig nicht ausnutzen und wenig Interesse an der Arbeit in den Mitbestimmungsgremien haben. Die Vertreterin der SchülerInnenkammer,
Sappho Beck, fand die Ursache dafür darin, daß die bestehende Schulkultur offenbar nicht in der Lage sei, Demokratie als Wert zu vermitteln. Gabriele Kandzora stellte klar, daß dies bei der bestehenden Reduktion von Demokratie auf die bloße Beteiligung an den institutionalisierten Mitbestimmungsgremien auch kein Wunder sei. Schüler müßten stattdessen von Anfang an und in allen Belangen - auch in denen des Unterrichtsgeschehens - ein weitgehendes Mitspracherecht erhalten. Ebenso wie der Vertreter der Elternkammer forderte sie eine Zusammenarbeit aller funktionalen Gruppen der Schule "auf Augenhöhe". Ein Schüler aus dem Publikum erklärte die Resignation von Schülern als eine Reaktion auf die Schulwirklichkeit und sah darin eine besondere Form der „Rebellion“. Während Kurt Edler noch weithin unausgeschöpfte Möglichkeiten innerhalb der bestehenden Strukturen sah, wie z.B. die Möglichkeit, zusätzlich zu den bestehenden Mitbestimmungsorganen weitere Gesprächs- und Entscheidungsgremien in der jeweiligen Schule zu schaffen und mit alten Gewohnheiten und Traditionen zu brechen, beurteilten andere in ihren Beiträgen die Chancen einer grundlegenden Veränderung unter den bestehenden Rahmenbedingungen eher skeptisch: Wo sollten die Zeiten und Räume für die Entwicklung gemeinsamer Aktivitäten bei Schülern und Lehrern herkommen, die nötig sind, um ein demokratisches Innenleben der Schule (Sappho Beck) sowie eine Öffnung der Schule zu einem „Kommunikations-Zentrum des Stadtteils“ (Rüdiger Winter) zu schaffen, wenn die Ganztagsschule nur eine Verlängerung des Unterrichtsvormittags in den Nachmittag hinein bedeutete und Lehrer mit voller Stelle inzwischen bis zu 30 Unterrichtsstunden pro Woche erteilen müssen?
Eine weitere Kontroverse entwickelte sich an Herbert Schalthoffs Forderung nach einem öffentlichen Schul-Ranking. Während einerseits die Auffassung vertreten wurde, eine solche Veröffentlichung von Schulevaluationsergebnissen sei ein Gebot der Demokratie (Kurt Edler), wurde andererseits von einigen Diskussionsteilnehmern daraufhingewiesen, daß die Entwicklung in den angelsächsischen Ländern gezeigt habe, daß eine demokratische Schule für Alle entweder auf dieses „Wettbewerbs-Instrument“ oder auf das Recht der freien Schulwahl verzichten müsse, wenn sie eine weitere Verschärfung der Exklusion benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen vermeiden wolle. Claudia Wetterhahn fragte darüberhinaus nach Kriterien eines Rankings, die nicht bloß die kongnitiven, sondern auch die sozialen und politischen Lernleistungen der Schüler bewerten könnten. Rüdiger Winter forderte von einem demokratischen „Schul-TÜV", daß auch das Feedback von Schülern, Eltern und außerschulischen Kooperationspartnern abzufragen sei.
Insgesamt lieferte die Tagung vielfältige Impulse für die nächsten Schritte auf dem Weg zu einer demokratischen Schule für Alle.
 Jazzmusik des Sinti Weiss Ensembles
Jazzmusik des Sinti Weiss Ensembles
 und das hervorragende Büffet der Schüler-Cateringfirma der Förderschule Pröbenweg
und das hervorragende Büffet der Schüler-Cateringfirma der Förderschule Pröbenweg
 boten die passende Atmosphäre für Erfahrungsaustausch und Diskussion im „World Café“.
boten die passende Atmosphäre für Erfahrungsaustausch und Diskussion im „World Café“.